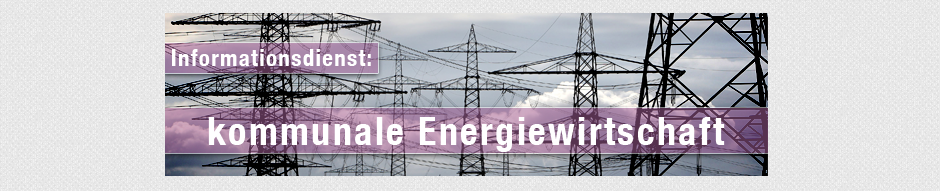Die Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG hat den Bau des Trianel Windparks Sundern im Hochsauerlandkreis gestartet. Mit zwölf Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von 67 Megawatt (MW) ist er nach seiner Fertigstellung der größte kommunale Windpark in Nordrhein-Westfalen. „Der Baustart dieses wegweisenden Erneuerbare-Energien-Projekts ist für uns ein großes Ereignis und das Ergebnis der hervorragenden Arbeit aller, die an Planung des Projekts beteiligt waren“, kommentiert Arvid Hesse, Geschäftsführer der Trianel Wind und Solar. „Gemeinsam mit der Stadt Sundern, die mit ihrer Tochtergesellschaft auch einen Teil des Windparks übernehmen wird, treiben wir die kommunale Energiewende weiter voran. Künftig können wir rechnerisch eine größere Stadt mit grünem Strom aus dem Windpark Sundern versorgen.“ Ein besonderer Fokus wird im Rahmen der Bauarbeiten auf die Reduzierung der Verkehrsbelastung gelegt. In einem konstruktiven Austausch mit der Stadt Sundern und den Ortsvorstehern aus Allendorf, Endorf, Hagen, Stemel, Sundern und Stockum wurden einzelne Maßnahmen festgelegt, um die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner während der Bauphase so gering wie möglich zu halten. So beruht beispielsweise die Zuwegung auf einem Einbahnstraßen-Konzept, wodurch die Verkehrsführung optimiert und die Belastungen durch LKW-Fahrten reduziert werden. Die Fertigstellung des Windparks ist für Ende 2026 vorgesehen. Drei der Windenergieanlagen werden anschließend der Sundern ENERGIE GmbH angeboten und sollen damit die kommunale Wertschöpfung vor Ort stärken. Der Betrieb erfolgt durch das Trianel Netzwerk. (Trianel, 22.04.2025) Ganzer Artikel hier…
Wärmewende zentral für die Erreichung der Klimaziele
Mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Endenergie in Deutschland wird für das Beheizen von Gebäuden sowie für Wärme- und Kälteanwendungen in Gewerbe und Industrie genutzt. Eine klimaneutrale Wärmeversorgung ist von großer Bedeutung für das Erreichen der Klimaziele und das Gelingen der Energiewende. Doch bislang beträgt der Anteil Erneuerbarer Energien im Wärmesektor nur rund 22 Prozent. Hier besteht Handlungsbedarf. „Der Koalitionsvertrag benennt zentrale Elemente der Wärmewende und setzt damit wichtige Impulse für die Dekarbonisierung der Wärme“, sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. „Jetzt kommt es darauf an, zügig in die konkrete Ausgestaltung zu gehen – für Planungs- und Investitionssicherheit statt Verunsicherung und Stillstand. Vor allem die Diskussion um das sogenannte Heizungsgesetz hat in den vergangenen Jahren große Verunsicherung ausgelöst. Was wir brauchen, ist kein vollständiger Systemwechsel, stattdessen aber Verlässlichkeit, Klarheit und Vereinfachungen. Menschen, Handwerk, Gewerbe, Handel, Industrie und die Energieversorgungsunternehmen brauchen ein ausgereiftes und realistisches Gesamtkonzept für eine klimaneutrale Wärmeversorgung.“ Die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung muss entschlossen vorangetrieben und die Wärmewende für alle Beteiligten praktikabel gestaltet werden. Die notwendige Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) bis Mai 2026 aufgrund europarechtlicher Vorgaben bietet die Chance, die Rahmenbedingungen realistisch und praxisgerecht zu gestalten – und gleichzeitig Kontinuität bei den wesentlichen Eckpfeilern zu sichern. Positiv ist, dass der Koalitionsvertrag die Bedeutung der Gasinfrastruktur für eine sichere Wärmeversorgung anerkennt. „Die Transformation der Gasnetze dient nicht nur der zukünftigen Wärmeversorgung, sondern auch der künftigen Nutzung von Wasserstoff in Industrie und Stromerzeugung“, so Andreae. „Für diese Umstellung braucht es Planungssicherheit, regulatorische Klarheit und vor diesem Hintergrund einer zügigen Umsetzung des EU-Gas- und Wasserstoffpakets.“ Die Förderung effizienter Wärmenetze (BEW) ist ein wichtiger Hebel – sie muss aber mit ausreichenden Mitteln ausgestattet sein. Der BDEW fordert hier ein Fördervolumen von mindestens 3,5 Milliarden Euro jährlich. Es ist ein zukunftsweisendes Signal, dass die gesetzliche Verankerung und Aufstockung der BEW im Koalitionsvertrag ausdrücklich festgehalten wurde. Ziel muss es außerdem sein, faire und transparente Marktbedingungen zu schaffen – ohne neue bürokratische Hürden. Die angekündigte Modernisierung der AVBFernwärme-Verordnung und der Wärmelieferverordnung ist sinnvoll, muss jedoch ausgewogen gestaltet werden. Eine staatliche Preisaufsicht ist hier nicht das geeignete Mittel. Stattdessen sollte die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht bei den Endkundenpreisen im Fernwärmesektor gestärkt werden. „Unternehmen müssen enorme Investitionen stemmen – hier braucht es eine gezielte Kombination aus privatem Kapital und staatlicher Unterstützung. Der im Koalitionsvertrag verankerte Investitionsfonds ist ein wichtiger Schritt, insbesondere wenn er im Wärmesektor genutzt wird, um Investitionen auszulösen, Vertrauen zu schaffen und die notwendige Transformation planbar zu machen“, erklärt Andreae. (BDEW, 16.04.2025) Ganzer Artikel hier…
Fernwärmeausbau: VKU begrüßt „Sofort-Zuschuss“ für Fördertopf
Das Bundesfinanzministerium hat laut Medienberichten auf Antrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 2025 einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung von bis zu 305 Millionen Euro zugestimmt. Damit soll die „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze“ (BEW) ohne Unterbrechung fortgeführt werden können. VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing: „Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze ist das zentrale Förderprogramm für Ausbau und Dekarbonisierung der leitungsgebundenen Wärmeversorgung. Das Programm ist sehr gut, hat sich bewährt und muss ohne Unterbrechung weitergehen, damit die Wärmewende richtig Fahrt aufnehmen kann. Dass das Bundesfinanzministerium die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bewilligt hat, ist ein wichtiges Signal, das wir ausdrücklich begrüßen. Besonders wichtig ist nun, dass mit der im Koalitionsvertrag vorgesehenen gesetzlichen Verankerung eine dauerhafte und erhöhte Finanzierung gesichert wird. Die Nachfrage nach Fördermitteln ist hoch, und das Programm unterfinanziert: Bereits jetzt gibt es unbewilligte Förderanträge mit einem Volumen von insgesamt mehr als einer Milliarde Euro. Das belegt den hohen Handlungsdruck und widerlegt gleichzeitig eine frühere Argumentation, es sei noch genügend Geld im Fördertopf. Nun kommt es auf eine zeitnahe und einfache Umsetzung an, damit Anträge unbürokratisch und zügig bearbeitet und bewilligt werden können: Dazu müssen bereits mit dem noch zu beschließenden Bundeshaushalt 2025 ausreichend Mittel bereitgestellt werden. Nötig ist für die nächsten Jahre ein Hochlauf der Fördermittel auf 3,5 Milliarden Euro pro Jahr. Wir gehen von einem weiteren Anstieg von Förderanträgen aus, da die Kommunen beim Fernwärmeausbau im Zuge der kommunalen Wärmeplanung erst am Beginn stehen. Das Personal beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle muss weiter aufgestockt werden. Die personellen Ressourcen bei der Bewilligungsbehörde haben sich zuletzt zu einem Flaschenhals entwickelt.“ (VKU, 17.04.2025) Ganzer Artikel hier…
Wärmewende braucht Akzeptanz: Bürger erwarten frühe Beteiligung
Die Wärmewende kommt – doch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern wachsen die Sorgen. Finanzielle Belastungen, mangelnde Transparenz und fehlende Mitsprache gefährden die Akzeptanz lokaler Maßnahmen. Das zeigt der neue Bürgerbeteiligungsreport 2025 des Steinbeis-Instituts IKOME | Steinbeis Mediation, der die Einstellungen von 2.000 Menschen aus ganz Deutschland zur Bürgerbeteiligung bei Infrastrukturprojekten mit Schwerpunkt Wärmewende analysiert hat. Laut Studie empfinden 68 Prozent der Befragten ein hohes Konfliktpotenzial bei der Umsetzung der Wärmewende im eigenen Wohnumfeld – etwa durch neue Heizkraftwerke, Baustellen oder Anschlusszwänge. Größte Sorgen: die eigene finanzielle Belastung (59 Prozent) sowie steigende Kosten für die Allgemeinheit (48 Prozent). Besonders problematisch: 72 Prozent fühlen sich über die kommunalen Planungen schlecht informiert. 58 Prozent kennen nicht einmal die Maßnahmen in ihrer eigenen Stadt oder Gemeinde. Die Erwartungen an eine bessere Einbindung sind hoch. 81 Prozent halten Beteiligungsmöglichkeiten bei der Umsetzung der Wärmewende für wichtig oder sehr wichtig, knapp jeder Zweite fordert eine Einbindung bereits vor Beginn der Planungen. Informationsbroschüren, lokale Medien und Online-Angebote stehen ganz oben auf der Wunschliste. „Die Signale der Bevölkerung sind eindeutig“, sagt Prof. Dr. Gernot Barth, Leiter von IKOME | Steinbeis Mediation. „Bürger wollen mitentscheiden, nicht erst wenn alles beschlossen ist. Wer Beteiligung auf später verschiebt oder nur als Pflichtübung versteht, riskiert Widerstand und Blockaden.“ 47 Prozent der Befragten sehen die Verantwortung für eine gelingende Beteiligung bei den Kommunen selbst – vor Fachämtern, Projektträgern oder neutralen Vermittlern. Die Studie empfiehlt deshalb eine aktive, frühzeitige und kontinuierliche Bürgerkommunikation – nicht nur zur Akzeptanzsteigerung, sondern auch zur Vermeidung teurer Verzögerungen. Die Wärmewende betrifft alle – und sie braucht alle. Wer die Bürger von Beginn an ernsthaft einbindet, verbessert nicht nur die Planungsqualität, sondern auch die Legitimation der kommunalen Entscheidungen. Der Bürgerbeteiligungsreport 2025 liefert dafür klare Daten – und einen klaren Appell. (Steinbeis-Mediation, 02.04.2025) Ganzer Artikel hier…
Fraunhofer ISE entwickelt ersten Qualitätsstandard für Wallboxen
Wallboxen zum Laden des Elektrofahrzeugs sind an immer mehr Eigenheimen zu finden. Doch wie lässt sich damit der Solarstrom vom eigenen Dach möglichst smart nutzen? Im Projekt »Wallbox-Inspektion« hat ein Konsortium aus Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, HTW Berlin und ADAC erstmals Prüfverfahren für solaroptimiert gesteuertes Laden entwickelt und marktverfügbare Wallboxen damit getestet. Gemeinsam mit einem Industriebeirat wurde ein Prüfleitfaden für das unidirektionale und solare Laden entwickelt, die Messergebnisse werden in einem Wallbox-Score für Endnutzer verständlich quantifiziert. Dies soll für Verbraucher die Transparenz im Wallbox-Markt erhöhen und einen Qualitätsstandard für die Industrie etablieren. Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Bis zum Jahr 2030 sollen Millionen Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein, die oft an privaten Ladestationen geladen werden. Aktuell finden 53 Prozent der Ladevorgänge zu Hause statt, besonders bei Besitzerinnen und Besitzern einer Photovoltaik-Anlage: 93 Prozent nutzen eine Wallbox, um ihr Elektrofahrzeug möglichst mit eigenem Strom zu laden oder durch entsprechend angepassten Betriebs der Wallbox zusätzlich von zeitvariablen Strompreisen zu profitieren. Wie dies möglichst exakt und wirtschaftlich geregelt werden kann, untersucht das Projekt »Wallbox-Inspektion«. Im Digital Grid Lab des Fraunhofer ISE wurden Wallbox-Lösungen verschiedener Hersteller unter identischen und realitätsnahen Betriebsbedingungen getestet. Im Fokus der Tests standen neben dem Stromverbrauch im Betrieb und im Stand-by-Modus die Regelungsgüte und Betriebseffekte, die beim solaren Laden von Elektrofahrzeugen eine zentrale Rolle spielen. Hier steht besonders die Frage im Vordergrund, wie ein solarer Überschuss möglichst gut in ein Elektrofahrzeug eingespeichert wird, und wie bei kleinen Leistungen zwischen dem 1- und 3-phasigen Betrieb umgeschaltet werden kann. Die im Projekt entwickelten Tests betrachteten den Stromfluss zwischen Photovoltaikanlage, Haushalt, Stromnetz und Elektrofahrzeug. Die Forschenden maßen, welchen erlaubten maximal verfügbaren Ladestrom die Wallbox an das Fahrzeug kommunizierte. Über diesen Wert lässt sich die Stromaufnahme des Fahrzeuges entsprechend des solaren Angebots steuern. Der maximal verfügbare Strom ist dabei der Solarüberschuss, der nach Abzug des im Haushalt benötigten Stroms übrigbleibt. Das Energiemanagementsystem – in die Wallbox oder das Energy Meter integriert – überwacht dabei über das Energy Meter den Netzanschluss und steuert über die Wallbox das Elektrofahrzeug. Für das Testen der Ladestation kamen keine echten Fahrzeuge zum Einsatz, sondern der digitale Fahrzeug-Zwilling »ev twin« des Fraunhofer ISE, der das Verhalten von 5.000 verschiedenen E-Autos simulieren kann. Dies bietet den Vorteil, dass nach dem Ladetest für einen weiteren Test kein Fahrzeug leergefahren werden muss. Stattdessen wird der Leistungsfluss mit bidirektionalen Netzteilen emuliert. Weiterer Vorteil: die Einflüsse verschiedener Laderegler im Fahrzeug sind eliminiert. Das Team testete das Reaktionsverhalten der Wallbox in spezifischen realitätsnahen Situationen, wie dem Standby-Modus und verschieden großen Sprüngen in der Leistung der Solaranlage. »Eine schnelle Regelgeschwindigkeit bei hoher Regelgüte ist entscheidend für das solargesteuerte Laden. Im praktischen Betrieb bedeutet dies, dass die Steuerung durch die Wallbox dem solaren Überschuss möglichst gut folgt«, erklärt Dr. Bernhard Wille-Haussmann, Projektleiter »Wallbox-Inspektion«. Die getesteten Wallboxen reagierten unterschiedlich schnell auf Änderungen im Solarstromangebot: während einige instantan die Ladeleistung anpassten, wiesen andere eine Verzögerung von bis zu 90 Sekunden auf. Auch im Standby-Betrieb zeigten die Geräte unterschiedliches Verhalten: einige gehen dabei in einen reduzierten Betrieb (Deep Standby), um Strom zu sparen. Es hat sich aber auch gezeigt, dass bei vielen Wallboxen für eine gute Regelqualität das Energiemanagementsystem angepasst werden muss: Die Forschenden empfehlen Nutzerinnen und Nutzern von Wallboxen generell, das Gerät auf das Fahrzeug und die eigenen Bedürfnisse einzustellen. »Die Geräte arbeiten dann präziser als unter Standardeinstellungen. Auch die Unterschiede zwischen den Geräten der verschiedenen Hersteller sind dann nicht mehr so groß. Die Eigenheiten des eigenen Energiesystems spielen eben eine große Rolle«, erläutert Dr. Bernhard Wille-Haussmann. Auf Basis der Messergebnisse erstellt die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin einen Wallbox-Score, der die Qualitätsunterschiede zwischen den Produkten quantifiziert. Grundlage hierfür sind Simulationsrechnungen, die auf Messungen gemäß Testleitfaden basieren. Der ADAC e.V. nutzt die Ergebnisse aus dem Projekt für die Beratung von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Über das transparente und einheitliche Messverfahren und die Messergebnisse will das Projektteam zudem den Wallboxherstellern konkrete Optimierungspotenziale im Hinblick auf die Qualität und Energieeffizienz ihrer Geräte aufzeigen. Endanwendern und Installateuren zeigen die Ergebnisse auf, welche Parametereinstellungen zu einer guten Solarenergienutzung führen. (Fraunhofer ISE, 22.04.2025) Ganzer Artikel hier…