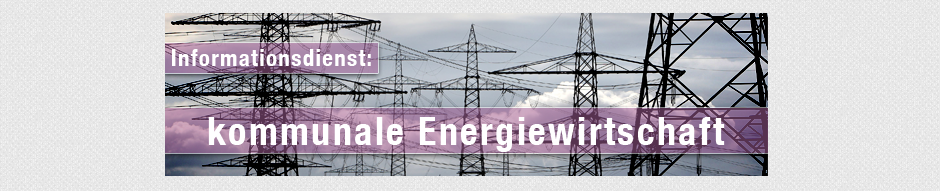Spätestens bis zum 30. Juni 2026 – müssen Städte in Deutschland mit mehr als 100.000 Einwohnern einen kommunalen Wärmeplan vorlegen. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Das ist ein wichtiger Meilenstein für die Wärmewende. „Für die Kommunen ist das eine große Herausforderung, aber auch eine wichtige Aufgabe. Die enorme Aktivität, mit der die Pläne bundesweit erstellt werden, freut uns sehr. Aber die Pläne sollen nicht in der Schublade verschwinden, sondern müssen auch umgesetzt werden“, so die Zwischenbilanz von Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) anlässlich der Vorstellung eines Gutachtens zu den Kosten verschiedener Wärmeoptionen. Liebing weiter: „Es muss von Seiten der Politik ein entsprechender Finanzierungs- und Marktrahmen geschaffen werden, der die Wärmewende in der Praxis ermöglicht. Andernfalls bleiben die kommunalen Wärmepläne insbesondere beim entscheidend wichtigen Wärmenetzausbau bloße Absichtserklärungen, ohne Aussicht auf konkrete Umsetzung.“ Beim Gebäudeenergiegesetz seien Kurskorrekturen für mehr Praxistauglichkeit nötig, aber es dürfe auch keine Rolle rückwärts geben. AGFW und VKU nennen fünf Punkte, wie die Bundesregierung kommunale Energieversorger besser unterstützen kann, damit aus Wärme-Plänen eine echte Wärmewende wird:
- Gebäudeenergiegesetz und Wärmeplanungsgesetz rechtssicher ausgestalten: Bei einer Reform des Gebäudeenergiegesetzes müssen die Wechselwirkungen mit dem Wärmeplanungsgesetz mitgedacht werden, beide Regelungen sind eng miteinander verzahnt. Kommunen, Stadtwerke und Hausbesitzer brauchen Klarheit.
- Mehr Geld für die Wärmewende: Die Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) muss auf mindestens 3,5 Milliarden Euro pro Jahr aufgestockt und bis 2035 verlängert werden. Das Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz sollte ebenfalls schnellstmöglich verlängert und auf den Betrieb mit klimaneutralen Gasen ausgerichtet werden.
- Weniger Bürokratie: Überflüssige oder nicht praxistaugliche Vorgaben – etwa komplexe Übergangslösungen für den Anschluss an Wärmenetze im GEG – sollten ersatzlos gestrichen oder stark vereinfacht werden.
- Technologieoffenheit sichern: Das GEG und WPG müssen alle klimaneutralen Wärmequellen – auch Biomasse, Abwärme und Wasserstoff gleichwertig einbeziehen.
- Fairness und Fördereffizienz stärken: Die Wärmeplanung muss auf effiziente Fördermittelvergabe fokussiert werden: In Gebieten, in denen Wärmepläne zum Beispiel Fernwärme als beste Option ausweisen, sollten keine Fördermittel mehr für Wärmepumpen gezahlt werden. Die Optionen blieben möglich, jedoch würde kein Steuergeld mehr fließen. Die Pflicht zur Veröffentlichung von Dekarbonisierungsfahrplänen sollte nur zusammenfassend erfolgen, um sensible Daten zu schützen.
Fairer Wettbewerb zwischen Heiztechnologien
„Viele bereits erstellte Wärmepläne sehen den Ausbau von Wärmenetzen vor“, sagt Liebing. Allerdings werde der Ausbau der Fernwärme in vermieteten Bestandsgebäuden seit vielen Jahren durch das Kostenneutralitätsgebot von § 556c BGB und Wärmelieferverordnung gehemmt. „Der Paragraf ist das zentrale regulatorische Hemmnis für den Ausbau von Wärmenetzen – und damit auch eine wesentliche Hürde für die Umsetzung der Wärmepläne”, so Liebing.
Ein von AGFW und VKU bei ITG Dresden in Auftrag gegebenes Kurzgutachten zeigt, dass der Heizungstausch zum Zeitpunkt der Umstellung bei nahezu allen untersuchten Heizungstechnologien mit Mehrkosten verbunden ist. Die Mehrkosten betragen monatlich rund 50 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche. Damit entsprechen sie der neu eingeführten Modernisierungsumlage für neue Heizungen (§556c BGB). Beim Anschluss an ein Wärmenetz kann diese Umlage jedoch nicht gleichermaßen wie beim Einbau einer Wärmepumpe genutzt werden.‘
„Der Spielraum für klimafreundliche Heizlösungen wird dadurch stark eingeschränkt, da die Regelung einseitig den Heizungstausch durch den Vermieter bevorzugt“, so AGFW-Geschäftsführer Werner Lutsch. „So darf der Vermieter bei einem Einbau einer Wärmepumpe Investitions- und Betriebskosten auf die Mieter umlegen, beim Anschluss an ein Fernwärmenetz ist das nicht möglich. Das führt zu einer Wettbewerbsverzerrung und benachteiligt effiziente Technologien wie Fernwärme. Was wir brauchen, ist ein fairer Wettbewerb der Technologien. Das Gutachten zeigt: Ein monatlicher Mietaufschlag von 50 Cent pro Quadratmeter würde ausreichen, um Investitionen wirtschaftlich tragfähig zu machen. Gleichzeitig bleibt der Mieterschutz erhalten.“
Um den Anschluss an ein Wärmenetz als auch den Umstieg auf Contracting zu ermöglichen, muss der Paragraph § 556c BGB novelliert werden. AGFW und VKU schlagen vor, einen zusätzlichen Betrag von maximal 50 Cent (pro Quadratmeter und Monat) im Kostenvergleich zu berücksichtigen. Der Vorschlag der Verbände orientiert sich an bereits bestehenden mietrechtlichen Bestimmungen zur Aufteilung der Kosten einer neuen Heizungsanlage zwischen Vermietenden und Mietenden. Er schafft damit vergleichenden Wettbewerbsbedingungen zwischen der “Eigenversorgung” – also, wenn der Vermietende selbst in eine Heizungsanlage investiert und diese auch selbst betreibt – und dem Umstieg auf eine gewerbliche Wärmelieferung, zu der neben Fernwärme auch Contracting gehört.
Rund die Hälfte des Energieverbrauchs in Deutschland entfällt auf Wärme. Noch immer stammen 80 Prozent aus fossilen Quellen wie Gas oder Öl. Bis 2045 soll die Wärmeversorgung klimaneutral werden. Kommunale Unternehmen und Stadtwerke kennen die Gegebenheiten vor Ort und haben das Know-how für den Umbau der Wärmeversorgung. „Ohne klare Regeln für die Umsetzung bleibt der Wärmeplan ein Papiertiger. Jetzt ist die Politik am Zug“, so Liebing. (VKU, 26.06.2025) Ganzer Artikel hier…