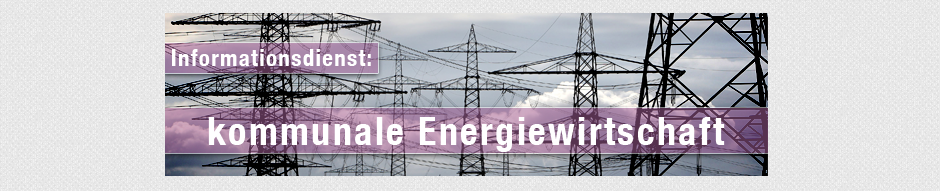Die Bundesregierung hat ihre lang erwarteten Eckpunkte zur Reform des Gebäudeenergiegesetzes vorgelegt. Die Reaktionen aus Wirtschaft, Kommunalverbänden und Umweltorganisationen fallen gespalten aus: Grundsätzliche Anerkennung für mehr Klarheit – verbunden mit deutlichen Warnungen vor Kostenfallen und klimapolitischen Rückschritten. Kommunale Spitzenverbände, allen voran der VKU, begrüßen die geplante gesetzliche Verankerung und Aufstockung der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW). Die Förderung gilt als notwendige Anschubfinanzierung, um Investitionskosten zu dämpfen und Endverbraucherpreise stabil zu halten. VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing macht jedoch deutlich: Ankündigungen allein reichen nicht. Entscheidend sei, dass die Mittel tatsächlich fließen. Parallel fordern die Verbände eine Novellierung der Wärmelieferverordnung. Derzeit können Vermieter Investitionskosten für Wärmepumpen umlegen, nicht aber für Fernwärmeanschlüsse. Diese rechtliche Schieflage drohe Mieter in veralteten Versorgungsstrukturen zu halten – und bremst damit den Netzausbau vor Ort. Deutlich kritischer fällt die Bewertung der geplanten Grüngasquote aus. Die vorgesehene Beimischpflicht von zunächst einem Prozent Biomethan oder Wasserstoff wird vom VKU als kaum praxistauglich eingestuft: Grüne Gase sind nicht flächendeckend verfügbar, die Infrastruktur für Wasserstofftransport fehlt vielerorts noch. Umweltverbände wie die Deutsche Umwelthilfe gehen weiter und sehen in der Quote eine Absicherung fossiler Geschäftsmodelle auf Kosten des Klimaziels 2045. Für Stadtwerke bleibt die Botschaft zwiespältig. Wer auf Fernwärme setzt, bekommt grundsätzlich Rückenwind – sofern die Fördermittel verlässlich fließen und die Wärmelieferverordnung angepasst wird. Wer im Gasgeschäft aktiv ist, steht vor einer strategischen Neubewertung: Die Grüngasquote schafft kurzfristig Spielraum, löst aber keine der strukturellen Fragen zur Verfügbarkeit und Infrastruktur. Der parlamentarische Prozess hat gerade erst begonnen. Ob die Reform tatsächlich Investitionssicherheit bringt, entscheidet sich in der Detailausgestaltung des Gesetzentwurfs – nicht in den Eckpunkten. (KEW, 25.02.2026) Mehr Infos hier…
Ladeinfrastruktur 2026: Regulierung zwingt Stadtwerke zum Handeln
Anfang 2026 hat der Markt für öffentliche Ladeinfrastruktur eine neue Reifephase erreicht. Rund 194.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte verzeichnete die Bundesnetzagentur zum Jahresbeginn – ein Zuwachs von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Entscheidender als die Anzahl ist jedoch die Qualität: Der massive Rollout von Hochleistungsladeanlagen (HPC) hat die kumulierte Ladeleistung auf über 8 Gigawatt gehoben. Die Frage ist nicht mehr, ob Ladeinfrastruktur vorhanden ist, sondern ob sie zuverlässig funktioniert. Parallel verschärft sich der gesetzliche Rahmen. § 7c EnWG verlangt die klare Trennung von Netzbetrieb und Ladesäulenbetrieb – die Übergangsfrist läuft bis zum 31. Dezember 2026. Für Stadtwerke, die diesen Prozess bislang aufgeschoben haben, wird die Zeit knapp. Die gesellschaftsrechtliche Entflechtung ist komplexer als oft angenommen: Eine überhastete Ausgliederung kann den steuerlichen Querverbund gefährden, eine zu späte Umsetzung regulatorische Sanktionen der Bundesnetzagentur nach sich ziehen. Beides ist vermeidbar – aber nur mit ausreichend Vorlauf. Die regulatorische Pflicht trifft auf eine betriebswirtschaftliche Realität, die viele Stadtwerke intern bereits spüren: Der Betrieb von Ladeinfrastruktur ist kleinteilig, wartungsintensiv und setzt hohe technische Standards voraus. Eine Systemverfügbarkeit von 98 bis 99 Prozent gilt heute als faktische Marktzulassung. Dazu kommen IT-Sicherheit, eichrechtskonforme Abrechnung, 24/7-Support und moderne Bezahlsysteme – Fixkosten, die sich bei kleinen Portfolios kaum skalieren lassen. Stefan Kutz, der beim Münchener Full-Service-Anbieter Wirelane, den Stadtwerkebereich verantwortet, nennt in einem aktuellen Interview mit dem Deutschen Kommunalinformationsdienst DEKOM eine konkrete Schwelle: Bei unter 50 bis 60 Ladepunkten fressen die Fixkosten die Margen auf. Für viele kommunale Betreiber ist das eine ernüchternde Bestandsaufnahme – und zugleich ein klarer Orientierungspunkt für die strategische Entscheidung. Die Konsequenz muss nicht der vollständige Ausstieg sein. Wirelane etwa bietet Stadtwerken differenzierte Partnerschaftsmodelle: Bei laufenden Förderbindungen empfiehlt sich der Betriebsführungsübertrag – das Stadtwerk bleibt Eigentümer, überträgt aber das operative Risiko. Ist die Zweckbindung abgelaufen, kann eine vollständige Übernahme sinnvoll sein. In beiden Fällen bleibt die lokale Sichtbarkeit erhalten: White-Labeling im Corporate Design des Stadtwerks und Energielieferverträge mit dem örtlichen Versorger sichern die regionale Wertschöpfung. Für Geschäftsführung und Verwaltungsrat hat sich damit die Rahmung verändert. Elektromobilität ist kein Prestige- oder Klimaprojekt mehr, das man sich leistet oder nicht. Es ist ein Governance- und Risikothema mit konkreten Fristen, messbaren Qualitätsstandards und wirtschaftlichen Konsequenzen. Wer jetzt keine strukturierte Strategie entwickelt, riskiert, zwischen politischem Anspruch und betriebswirtschaftlicher Realität zerrieben zu werden. (KEW, 25.02.2026) Mehr Infos hier…
Stadtnetze Münster: Organisation als Wettbewerbsvorteil im Glasfaserausbau
Wenn Anschlusszahlen steigen, reichen informelle Prozesse nicht mehr aus. Die Stadtnetze Münster zeigen, wie kommunale Netzbetreiber ihre Serviceorganisation zukunftsfähig aufstellen – bevor der Druck zu groß wird. Der Erfolg im Breitbandausbau entscheidet sich längst nicht mehr allein am Grabenrand. Während Tiefbaukapazitäten und Fördermittel die öffentliche Debatte um den Glasfaserausbau dominieren, gewinnt ein dritter Faktor zunehmend an strategischer Bedeutung: die Leistungsfähigkeit der internen Serviceorganisation. Denn mit jeder neuen Trasse, jedem neuen Anschluss wächst auch das operative Volumen – an Kundenanfragen, Baustellenkoordinationen und abteilungsübergreifenden Abstimmungsprozessen. Wer diesen Anstieg nicht strukturell einplant, verliert Steuerbarkeit genau dann, wenn der Ausbau Fahrt aufnimmt. Die Stadtnetze Münster haben diesen Kipppunkt früh erkannt. Gemeinsam mit dem IT-Service-Management-Spezialisten performio wurde ein zentrales Ticket- und Prozessmanagementsystem eingeführt, das heute als operatives Rückgrat für rund 110 Mitarbeitende im Glasfaserumfeld dient. Das Prinzip ist einfach, die Wirkung weitreichend: Jede eingehende Anfrage – ob von Bürgerinnen und Bürgern, Baufirmen oder aus eigenen Fachabteilungen – wird automatisch erfasst, priorisiert und einer klar definierten Zuständigkeit zugewiesen. Manuelle Statusabfragen und die Suche in persönlichen Postfächern entfallen. Vertretungsregelungen sind systemisch hinterlegt, Bearbeitungsfristen werden automatisiert überwacht. Für die Unternehmensführung zahlt sich dieses Vorgehen auf mehreren Ebenen aus. Erstens steigt die Belastbarkeit der Organisation: Auch bei hohen Lastspitzen – etwa in intensiven Ausbauabschnitten – bleibt die Handlungsfähigkeit erhalten. Zweitens entsteht aus dem strukturierten Tagesgeschäft eine belastbare Datenbasis, die Engpässe sichtbar macht, bevor sie eskalieren, und eine gezielte Ressourcensteuerung ermöglicht. Das Ergebnis ist mehr als ein IT-Projekt. Die Stadtnetze Münster haben sich mit diesem Schritt einen organisatorischen Standortvorteil erarbeitet, der im Wettbewerb um Ausbauziele, Fördergelder und Kundenzufriedenheit zunehmend zum Differenzierungsmerkmal wird. (KEW, 25.02.2026) Mehr Infos hier…
Norderney: Qualitätssicherung als Erfolgsfaktor im Glasfaserausbau
Tiefbaumängel, Schnittstellenprobleme, überlastete Generalunternehmer – der Glasfaserausbau scheitert selten an der Technik, aber häufig an der Steuerung. Das Beispiel Norderney zeigt, wie externe Fachbegleitung Risiken systematisch beherrschbar macht. Der Glasfaserausbau stellt kommunale Unternehmen nicht nur technisch, sondern vor allem organisatorisch vor erhebliche Herausforderungen. Zwischen Tiefbau, Genehmigungsprozessen, Hausanschlussmanagement, Dokumentation und Aktivierung entstehen komplexe Schnittstellen, an denen Projekte regelmäßig an Tempo und Budget verlieren. Wer diese Risiken unterschätzt, zahlt sie später – in Nacharbeiten, Verzögerungen und gebundenem Kapital. Auf Norderney begann das Projekt nicht mit dem ersten Spatenstich, sondern mit einer systematischen Bestandsaufnahme. Mehr als 100 Gebäude wurden einzeln begangen, technische Realisierbarkeit und hausindividuelle Besonderheiten präzise erfasst. Was nach Verwaltungsaufwand klingt, war in Wirklichkeit die Grundlage für belastbare Bauplanung und Kostenkontrolle – und damit die Voraussetzung dafür, dass spätere Entscheidungen auf Fakten statt auf Annahmen beruhen. Die fachliche Begleitung des Projekts übernahm Rainer Staar, dessen Unternehmen fiberprojects auf technische Baukontrolle, Projektstrukturierung und Behördenkoordination im Glasfaserausbau spezialisiert ist. Die externe Qualitätssicherung wirkte in mehreren Dimensionen gleichzeitig: technische Prüfung der Bauausführung, Unterstützung bei der Einarbeitung externer Kapazitäten, Koordination mit Behörden sowie sachliche Bewertung von Leistungsabweichungen. Als der ursprünglich beauftragte Generalunternehmer die vereinbarten Qualitätsanforderungen nicht erfüllte, wurde die Zusammenarbeit beendet. Eine Entscheidung, die ohne belastbare fachliche Dokumentation kaum durchsetzbar gewesen wäre – weder intern noch gegenüber dem Auftragnehmer. Für Geschäftsführungen und Aufsichtsgremien liegt die strategische Relevanz auf der Hand. Tiefbau ist der kostenintensivste und zugleich fehleranfälligste Bestandteil eines Glasfaserprojekts. Mängel in der Ausführung wirken sich direkt auf Nacharbeiten, Aktivierungsverzögerungen und letztlich auf Kapitalbindung und Refinanzierungsfähigkeit aus. Externe Qualitätssicherung ist damit kein Zusatzposten im Projektbudget, sondern ein Instrument aktiver Risikosteuerung – mit messbarer Wirkung auf Projektstabilität und Entscheidungsqualität. Die übertragbare Erkenntnis aus Norderney lautet: Glasfaserausbau ist kein Standardbauprojekt, sondern ein spezialisiertes Infrastrukturvorhaben mit hohem Steuerungsbedarf. Wer externe Fachkompetenz erst hinzuzieht, wenn Probleme sichtbar werden, handelt reaktiv. Wer sie von Beginn an integriert, reduziert Projektrisiken systematisch – und stärkt die Governance im Unternehmen. (KEW, 25.02.2026) Ganzer Artikel hier…
Smart City Fulda: Straßenbeleuchtung als Datenquelle
Wer Straßenleuchten nur als Energiesparprojekt begreift, verschenkt strategisches Potenzial. Fulda hat gezeigt, was möglich ist, wenn Kommunen konsequent weiterdenken. Die Modernisierung der Straßenbeleuchtung gilt in vielen Kommunen als klassische Effizienzmaßnahme: Alte Leuchten raus, LED rein, Stromkosten runter. Fulda hat diesen Ansatz von Anfang an weiter gefasst. 688 Straßenleuchten wurden auf LED-Technik umgerüstet und an das adaptive iLCS-Lichtmanagementsystem angebunden, das Helligkeit auf Hauptverkehrsachsen in Echtzeit steuert. Die Einsparungen sind beeindruckend – bis zu 79 Prozent gegenüber konventioneller Lampentechnik. Aber das ist nicht die eigentliche Pointe. Die Leuchte als Plattform Entscheidend ist, was an den 688 Standorten zusätzlich installiert wurde. Verkehrssensoren erfassen Verkehrsströme in Echtzeit und steuern Lichtsignalanlagen. Parkraumsensoren überwachen Stellflächen und helfen, Parksuchverkehr zu reduzieren. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren liefern Daten zu Hitzeinseln. Bodenfeuchtesensoren optimieren das Grünflächenmanagement. Füllstandsensoren in Altpapier- und Altglascontainern ermöglichen bedarfsgerechte Leerungsintervalle. Die Integration dieser Sensorik – technisch verantwortet von EBERO FAB – erfolgte ohne zusätzliche Masten oder neue Leitungswege. Alle Daten laufen per LoRaWAN in eine kommunale Datenplattform nach DIN SPEC 91357, die der Stadt die volle Datenkontrolle sichert. Die bestehende Beleuchtungsinfrastruktur wird damit zur dezentralen urbanen Serviceplattform. Die strategische Verschiebung Für Stadtwerke und kommunale Entscheider verändert das Fuldaer Modell die Perspektive grundlegend. Investitionen in Straßenbeleuchtung sind keine isolierten Ersatzbeschaffungen mehr – sie sind potenzielle Mehrzweck-Infrastrukturmaßnahmen. Wer bei der Planung systematisch mitdenkt, schafft die Grundlage für neue Dienstleistungen, Datenservices und Kooperationsmodelle, deren Wert weit über die Amortisation der LED-Technik hinausgeht. Die entscheidende Managementfrage lautet deshalb nicht mehr allein: Wann rechnet sich die Umrüstung? Sondern: Welchen Plattformwert kann diese Infrastruktur langfristig entfalten? Fulda hat darauf eine belastbare Antwort gegeben – im laufenden Betrieb. (KEW, 25.02.2026) Mehr Infos hier…